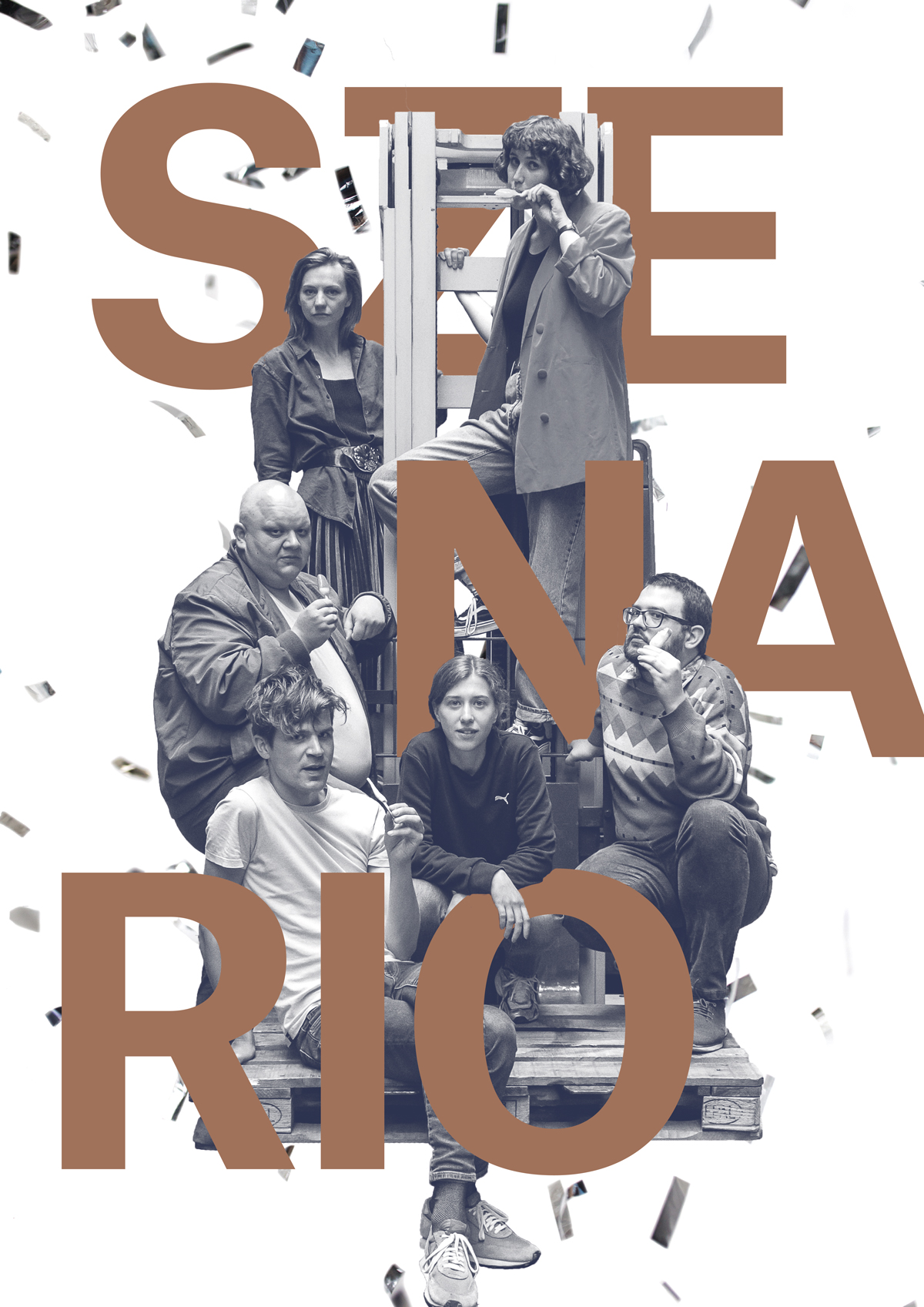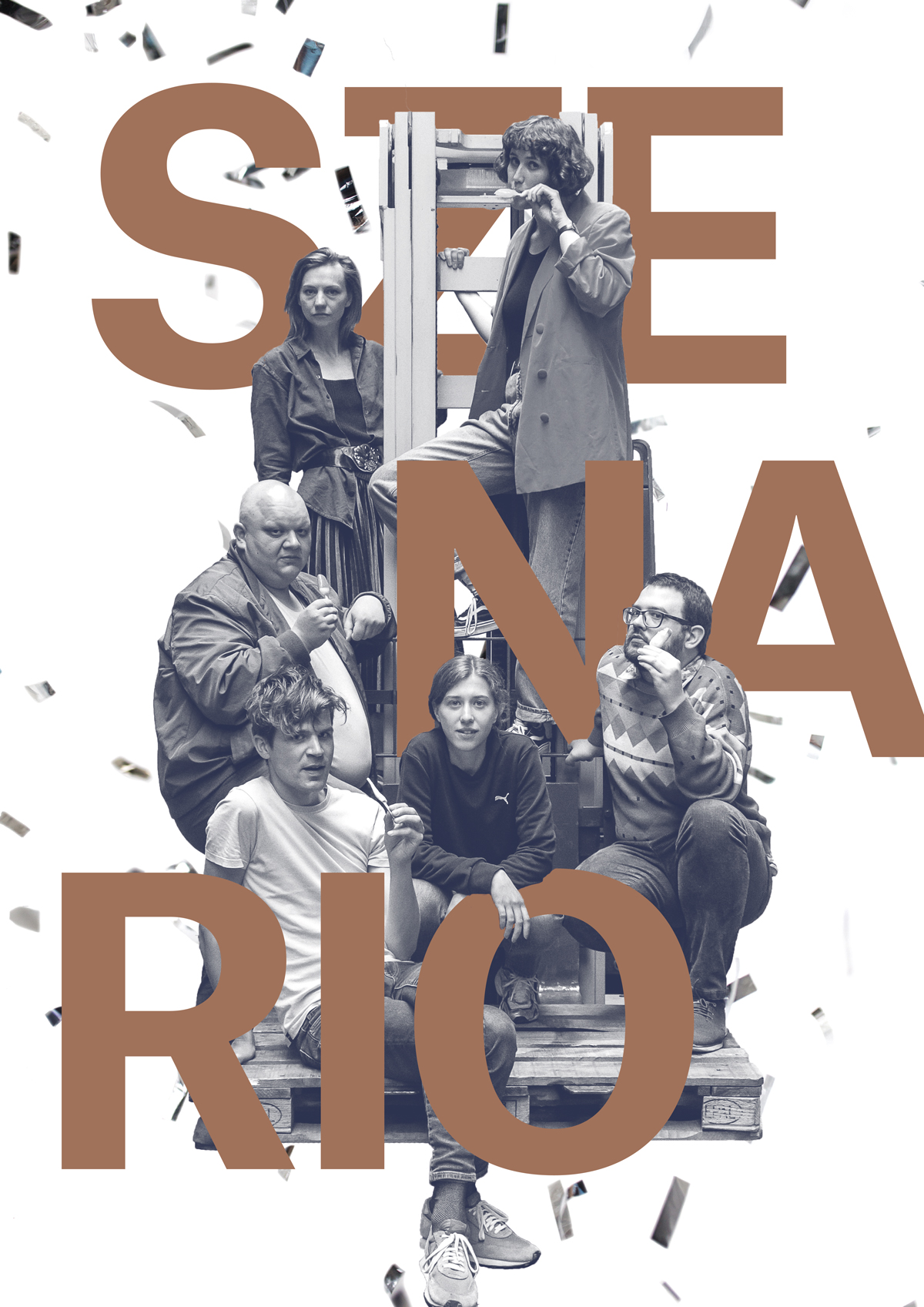Nachtkritik vom 7.6.2023
"Szenario" von Jan Philipp Stange
"Wie erfüllend ist Arbeit? Wie wird das Individuum entlohnt? Mit feiner Ironie bringt die Oper "Szenario" eine Reflexion über die Verwertung des Menschen im Neoliberalismus auf die Bühne – und ist dabei mindestens so schön anzusehen wie ein Weihnachtsmärchen.
Leidenschaftliche Selbstausbeutung gibt es mittlerweile überall. Aber die Künstlerinnen haben damit angefangen. Aus ihrem Traum, sich mit der eigenen Arbeit identifizieren zu können, hat der Kapitalismus das Bild vom Erwerbsarbeiter als Einzelkämpfer gestrickt, der unternehmerische Risiken ganz allein trägt. Inklusive der Existenzangst, die das mit sich bringt. – Das ist eine der Thesen von "Szenario", die die Darsteller*innen singend vortragen. Trotzdem bleibt eine Entfremdung zwischen der Kunst und anderen Arbeitswelten: "Ich weiß es nicht, stellen heute noch Menschen Schrauben her?", fragt einer der Sänger zu launiger Musik und müht sich an einer Fichte ab, die den verschneiten Weg versperrt. Was ist Arbeit? Ist sie sinnvoll? Und wie wird das Individuum entlohnt? Mit Humor und feiner Ironie bringt die Inszenierung eine Reflexion über die Arbeitszusammenhänge in einem neoliberalen, kapitalistischen System auf die Bühne – und ist dabei mindestens so schön anzusehen wie ein Weihnachtsmärchen."
Deutschlandfunk Kultur, 17.06.2023
„Jan Philipp Stange & Company bringen ein Problem der Freien Szene auf den Punkt: Ohne absurd bürokratisch ausgefüllten Antrag gibt es kein Geld. Gefragt sind die immer gleichen Ziele und Schlagworte, die berüchtigte Antragslyrik. Dass es um Inhalte vielleicht gar nicht mehr geht, zeigt dieses lustige, selbstreferenzielle Musical." (Über SZENARIO von Jan Philipp Stange & Company)
Deutschlandfunk, 21.11.2022, Musikjournal, 20:10 Uhr:
"Es gibt sie, die Traumbeziehungen der Musikgeschichte zwischen Komponist und Textdichter. Bei Mozart und Da Ponte etwa, oder bei Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal. In Ariadne auf Naxos haben diese beiden das Spiel zum Spiel erhoben, indem sie in der Oper eine Oper stattfinden lassen. Libretto und Musik gehen eng verzahnt Hand in Hand. Und wie ist es um das moderne Textbuch bestellt? Beim Performance Musical Szenario in Frankfurt hat man eine neue Quelle als Libretto erschlossen: den Förderantrag. Ein vor allem in Deutschland besonders geschätztes Formular und ein unerlässliches Scharnier innerhalb unserer Bürokratie. Ursula Böhmer hat verfolgt, wie der Förderantrag zum Gegenstand der Kunst wird.
(Windgeräusche)
UB: Es herrscht Eiseskälte im Studio Naxos, zumal in der ehemaligen Industriehalle in Frankfurts Osten eine Schneelandschaft im Wald aufgehäuft wurde. Zwischen Schneehügeln steckt eine umgekippte Fichte fest. Vier Waldarbeiterinnen und -arbeiter versuchen nun, den Baum aus dem Schnee und damit sozusagen den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ein passendes Bild für die freischaffende Kunstszene, die in sozialer Eiseskälte so manches Hindernis wegräumen muss, um ihre Projekte überhaupt zum Laufen zu bringen und stets auf Förderungen angewiesen ist.
(Ausschnitt aus Szenario)
UB: Der Förderantrag liefert dann auch das Libretto zum Performance Musical Szenario. Mit stoisch emotionslosem Gesichtsausdruck singen die vier Waldarbeiterinnen und -arbeiter die bürokratischen Floskeln der Antragsstellenden herunter. Vom Anschreiben über die Projektziele, den Kosten- und Finanzierungsplan bis hin zur finalen Datenschutzerklärung. Pianist und Arrangeur Jacob Bussmann hat all das in genüsslich eingängige Töne gekleidet. Mal bedient er das Broadway-Musical-Klischee, mal die Kurt-Weill-Schnauze (13:22), mal die Kirchenchoral-Empathie. Unterbrochen werden die Antragsfloskeln von persönlichen Interviewaussagen, die die Kunstschaffenden im Vorfeld von ihren Leidensgenossinnen und -genossen eingesammelt haben.
(Ausschnitt aus Szenario)
UB: Dominik Keggenhoff, Typ trauriger Tropf mit leicht gebeugter Haltung, besingt das Schicksal des freien Künstlers, der oft genug zu hören bekommt: „Beschwer dich nicht, du lebst in einer einzigartigen Theaterlandschaft, in dem dein Herumgemaule von der öffentlichen Hand finanziert wird.“
(Ausschnitt aus Szenario)
UB: Zwischen Heiterkeit, bitterer Ironie, eiskalter Nüchternheit und berechtigter Larmoyanz changiert der Abend, der klug und vortrefflich unterhält. Ideengeber ist der bereits mehrfach preisgekrönte Regisseur Jan Philipp Stange, Gründer und Co-Leiter des Studio Naxos in Frankfurt.
JPS: Die Gagen im freien Theater sind viel geringer als jetzt in den Schauspielhäusern und die Leute da arbeiten eigentlich fast alle relativ weitgehend unter Mindestlohn. Also im Moment gibt’s da ’ne Angleichung und es gab jetzt in den letzten zwei, drei Jahren während Corona tatsächlich viele Hilfsprogramme, die eigentlich erst offenbart haben, wie wenig Geld vorher auch gezahlt wurde und auch jetzt wieder gezahlt wird.
[...]
UB: Dass der Verdienst die eigentliche Arbeit nicht deckt, nehmen die freien Künstlerinnen und Künstler in Kauf. Das ändert aber nichts daran, dass noch viel Luft nach oben bleibt. Regisseur Jan Philipp Stange hätte daher eine dringende Botschaft an die Kulturpolitik in Berlin.
JPS: Claudia Roth soll bitte unbedingt die Bundesförderung aus der Corona-Pandemie verlängern und ausbauen. Zum Beispiel die Förderung des Fonds Darstellende Künste, die uns dieses Projekt ermöglicht hat, die wurde jetzt von- ich glaube in den Pandemiejahren hat der Fonds 164 Millionen bekommen und die wurde jetzt wieder auf das Vorkrisenniveau von 2019 auf 2 Millionen runtergestuft und das ist total bitter.
(Ausschnitt aus Szenario)
Ursula Böhmer über das Performance Musical Szenario in Frankfurt, wieder zu sehen am kommenden Freitag und am
Samstag."
Theater der Zeit, 29.06.2023
„Das Impulse Theater Festival 2023 ist sowohl ästhetisch als auch thematisch am Puls der Zeit. Es geht um aktuelle politische Krisen, Umbrüche und den Wunsch, etwas zu verändern (...). Es waren einmal vier desillusionierte Waldarbeiter:innen, die sich vor gar nicht allzu langer Zeit dem Theater verschrieben hatten. Der Traum von der Bühne treibt sie langsam, aber stetig in den finanziellen Ruin. Das Leben am Existenzminimum wird mit leidenschaftlicher Selbstausbeutung bezahlt. Ganz so, wie es die neoliberalen Strukturen des Kapitalismus von ihnen verlangen. Im Kapitalismus wird die Existenzangst in der zweieinhalbminütigen Mittagspause weggeatmet, während parallel noch kurz die Wäsche gewaschen, die Kinder versorgt und ein Förderantrag geschrieben wird. Alles kein Problem, oder?
Das Musical „Szenario“ widmet sich thematisch den bürokratischen Förderstrukturen in der freien Theaterszene und wirft gleichzeitig Fragen nach dem Verständnis und den Risiken von Arbeit im kapitalistischen Wirtschaftssystem auf. Jan Philipp Stange & Company finden sich auf einer verschneiten Straße wieder, die durch einen umgefallenen Baum blockiert wird. In gefühlvoller Selbstironie singen vier Performer:innen den Antrag für ihr Projekt „Szenario“. Es geht um Projektziele, Kostenplänen und die gesellschaftliche Relevanz des Vorhabens. Etwas, das selten mit der Utopie künstlerischer Arbeit in Verbindung gebracht wird und doch maßgeblich den Arbeitsalltag von Freiberufler:innen prägt. Um eine Bewilligung für den eigenen Projektantrag zu erhalten, werden die Performer:innen in „Szenario“ zu Waldarbeiter:innen. Da wird mit vereinten Kräften Schnee geschippt und der Baum von der Straße gehievt. Wie weit kann man sich von der eigenen Arbeit entfremden?
„Ich weiß es nicht, stellen heute noch Menschen Schrauben her? “
Die Frage nach den Arbeitsbedingungen in der freien Szene habe sich als ein wesentlicher thematischer Schwerpunkt des diesjährigen Impulse Theater Festivals herauskristallisiert, so der Kurator des Festivals Haiko Pfost. Die Kunst habe eine Art Modellcharakter, wenn es um Fragen nach Arbeitsstrukturen gehe, da sich gerade die freie Theaterszene schon lange mit den Bedingungen von Arbeit beschäftigen müsse. "Szenario” sei für dieses Thema die passende Produktion. "
(Yaël Koutouan)
KulturWest vom 31.5.23
"Die Neigung zur Nabelschau wird der Freien Szene immer mal wieder vorgeworfen. Wie humorvoll und unterhaltsam das aber auch sein kann, zeigen Jan Philipp Stange & Company in »Szenario«. Vier Waldarbeiter*innen singen da den Text eines Förderantrags, im üppigen Bühnenbild zwischen Kunstschneeflocken. Selbstkritisch und ironisch stellen sie sich ihren persönlichen Kämpfen mit Arbeit, Armut und Selbstverwirklichung."
(Sarah Heppekausen)
FAZ vom 25.11.22: "Ich sing dir was vor."
"Antragslyrik: Jan Philipp Stange zeigt im Studio der Frankfurter Naxoshalle, wie es ist, in Deutschland einen Antrag auf Kulturförderung auszufüllen. „Szenario“ ist Werk und Kommentar zugleich.
In [dem Antrag] gilt es zunächst, detailliert das geplante Projekt vorzustellen, seinen Inhalt und die Ziele zu skizzieren. Dann müssen präzise die angedachten „Aktivitäten zur Zielerreichung“ aufgeführt und ein bis auf die Kommastellen kalkulierter „Kosten- und Finanzierungsplan“ eingereicht werden. Der wichtigste Punkt aber ist die „angestrebte öffentliche Wirkung“. Hier gilt es, zumindest plausibel erscheinen zu lassen, dass das Theaterstück, die Performance oder das Schreibprojekt eine gewisse gesellschaftliche Relevanz besitzt. Im Antrag machen sich deshalb Worte wie „Kapitalismuskritik“, „Neoliberalismus“, „Ausbeutung“ und „Entfremdung“ ganz gut.
All dies erfährt man in knapp neunzig Minuten in „Szenario“ von Jan Philipp Stange im Studio Naxos. In der als „Performance Musical“ getarnten Selbstreflexion singen Ana Berkenhoff, Daniel Degeest, Alina Huppertz und Dominik Keggenhoff den Antragstext für genau diese Produktion als Libretto. Begleitet von Jacob Bussmann (Klavier), Jakob Boyny (Cello) und Špela Mastnak (Percussion und Vibrafon) singen sie mal allein, mal fast wie ein Chor im griechischen Theater, was genau mit diesem Stück bezweckt werden und welche Assoziationen die winterliche Bühnenlandschaft (Bühnenbild Jakob Engel) auslösen soll. [...]
Neben dem Antragstext sind es vor allem die höchst authentisch mit vielen „ähs“ und „weiß auch nicht, irgendwie“ gesungenen autobiographischen Passagen, die jenseits des Ulks etwas über die äußerst prekäre Situation von Künstlern, vor allem freischaffenden, erzählen. Hier offenbart sich, worum es eigentlich geht. Beutet sich der Künstler, der hier selbstredend immer korrekt mit Glottisschlag „Schauspieler:in“ genannt wird, permanent selbst aus und betrügt sich selbst durch seinen Glauben an eine nur scheinbar nicht entfremdete Arbeit?
[...| Das Stück ist wie ein Bild von M. C. Escher. Entstehung und Performance, Erzeugung und Kommentierung fallen in eins. Doch der zunächst verblüffende, ja begeisternde Grundeinfall wird auf Dauer ein wenig eintönig."
(Matthias Bischoff)
Leipziger Volkszeitung vom 22.3.2023: "Romeo, Giffey und die Musical-Hits von gestern."
"Die familientaugliche Aufbereitung eines Klassikers kann sogar aus kunstfernen Texten etwas zaubern. So kommt beim Impulse Theater Festival in NRW im Sommer das Musical „Szenario“ auf die Bühne. Dafür haben Jan Philipp Stange & Company einen Förderantrag vertont und kündigen an: „Vier Waldarbeiter*innen singen in verschneiter Landschaft über ,Aktivitäten zur Zielerreichung’, den ,Kosten- und Finanzierungsplan’ und ihre persönlichen Kämpfe mit Arbeit, Armut und Selbstverwirklichung“. Ja, Künstler können ein Lied davon singen."
(Janina Fleischer)
Jammer und Rührung
Philipp Scholtysik sprach am 19. November 2022 nach der Aufführung von SZENARIO mit einer zufälligen Person aus dem Publikum ->.
Philipp: Kannst du als erstes einmal erzählen, was du mit der Aufführung erlebt hast?
M: Ja. Wir sind reingekommen und dann war eine Schneelandschaft zu sehen. Das fand ich überraschend. Ein umgefallener Baum lag auf einem Weg und es sah kalt und neblig und verschneit aus und dann kam eine Person auf die Bühne. Soll ich noch über die ganze Aufführung reden?
P: Du brauchst nicht unbedingt die ganze Aufführung beschreiben, mich interessiert vor allem, was dein Erlebnis damit war.
M: Also mein Erlebnis war, dass ich, hm – ich habe viel an Musical gedacht. Ich glaube es war vielleicht das erste Mal, dass ich eine Theateraufführung erlebt habe, in der nur gesungen wurde und ich es richtig toll fand. Es war durchgehend witzig und blieb interessant, diese Antragstexte und diese Transkriptionen gesungen zu hören. Und das hat so geclasht natürlich: das Singen, diese Musical-Form, diese Hochkultur, diese Oper- oder Operettenform und dann dieser Inhalt und dann aber drittens noch dieses Bühnenbild, das eigentlich so Hänsel-und-Gretel-mäßig war. Also das waren drei Sachen, die so unterschiedlich waren, dass mich das die ganze Zeit in seinen Bann gezogen hat.
P: Kannst du eine Reaktion benennen? Was hat es bei dir ausgelöst?
M: Hm, Sympathie? Sympathie für die Leute, die sich das ausgedacht haben und an dem Projekt beteiligt waren, weil ich sofort das Gefühl hatte, das finde ich wirklich sehr, sehr witzig. Ich hatte das Gefühl, es wird etwas bearbeitet, wo ich mich reinversetzen kann, auch wenn ich selbst beruflich was anderes mache, aber ich konnte damit gut bonden.
P: Das klingt so, als wärst du sehr früh sozusagen an Bord gewesen, dem zu folgen, was da passiert. Wann hat sich das entschieden? Kann man das sagen?
M: Das hat sich eigentlich in dem Moment entschieden, als alle vier auf der Bühne waren. In dem Moment, als klar war, es gibt irgendwie so diese Vierergruppe, und dann eigentlich, als sie angefangen haben mit: „Sehr geehrte Damen und Herren“. Ab dann war ich an Bord.
P: Ab wann waren eigentlich diese drei Ebenen alle da? Die, die du vorher gesagt hast: Es wird gesungen, es gibt diese Art von Text und es gibt diese Szenerie.
M: Ich wollte wissen, was das alles zu bedeuten hat. Also ich wollte wissen: „Warum der Schnee? Warum der Baum?“ Ich wollte das enträtseln. „Ist das eine Allegorie? Steht der umgefallene Baum für die inneren Blockaden? Steht der Baum für die bürokratischen Hürden? Steht das Wegziehen des Baums für das Überwinden einer Blockade und ist eine Leistung und ein Erfolg? Oder wird es für etwas ganz anderes, überraschendes stehen?“ Das habe ich mich ganz lange gefragt. Also es wurde ja angekündigt, dass das klar werden wird, und dann dachte ich aber: „Wahrscheinlich bleibt das einfach so stehen und das ist einfach ein Setting, das gar keine bestimmte Bedeutung hat. Und es will wahrscheinlich, dass ich darüber nachdenke, welche Bedeutung es haben könnte, und es ist aber auch schlüssig, dass es das dann überhaupt nicht hat.“
P: Ist das eine Form von Neugierde – dieses Enträtseln? Oder ist das auch etwas, bei dem du das Gefühl hast: „Da will ich jetzt auch die Lösung finden und eigentlich nervt das irgendwie, wenn ich die nicht finde?“
M: Nein, das nervt mich nicht. Ich habe mich gefragt, wie sehr die Intention offengelegt werden wird. Wie wird das Stück damit umgehen, dass ich wissen will, was dieses Setting bedeutet? Und wie sehr werden sie sich auf eine Bedeutung festlegen? Und ich denke eher: „Oh nein, hoffentlich legen Sie diese Bedeutung nicht fest!“
P: Warum muss das Stück überhaupt damit umgehen, wie du dich fragst, was denn was bedeutet? Wie kommt es dazu, dass das überhaupt so eine Rolle spielt?
M: Das ist so: Die Bedeutung des Stücks ist eigentlich – also dieses Stück wurde beantragt und der Antrag für so eine Arbeit ist ja eigentlich nie Teil des Stücks, also von einem normalen Stück. Und in dem Fall ist aber die ganze Bedeutung des Stücks gewesen, dass man diesen Antrag quasi als alleinigen Inhalt auf die Bühne zieht. Über diese Antragsthematik und über dieses Textmaterial, darüber thematisiert man, was man so alles thematisieren kann. Zum Beispiel Entfremdung und Prekarität und diese Sachen. Und dieser Naturaufbau war halt überhaupt nicht vermittelt durch den Antragstext. Das war sozusagen eine raue zusätzliche Gegebenheit. Dieser Naturaufbau war deshalb sehr auffällig, weil das dann so eine äußere Landschaft war und man sich fragt, wie das zusammen geht: „Was hat das mit dem Antrag zu tun? Was hat der Antrag mit Schnee zu tun oder mit einem umgefallenen Baum oder mit so einem Astheber. Was hat das damit zu tun?“ Ich glaube auch der Astheber wurde gar nicht beantragt. Also er stand zumindest nicht in dem Finanzierungsplan.
P: War das so ein roter Faden für dich, womit du durchgehend beschäftigt warst, die Frage, wie diese verschiedenen Ebenen zusammenpassen?
M: Ja, also ich habe nicht die ganze Zeit nur über den Ast und den Schnee nachgedacht, aber es war ein roter Faden.
P: Kannst du einmal ganz simpel auflisten, was diese zwei Stunden geprägt hat?
M: Das Zentrale war die Musik, die Melodien, dass es gesungen war, dass es so Ohrwürmer gemacht hat. Also beim Rausgehen habe ich links und rechts neben mir gehört, wie andere Leute diesen Ohrwurm summen: „Wir willigen ein!“ Und man hat sich darauf verständigt, dass jetzt alle diesen Ohrwurm haben. Das war natürlich die Musik und der Gesang, den ich sehr schön fand.
Ich habe den sehr gerne gehört, diesen Gesang, ich fand das richtig schön.
P: Was heißt schön?
M. Das heißt – das ist ein Genuss – und dass es einen berührt eigentlich. Was natürlich gleichzeitig wieder witzig ist, weil es so ironisch wirkt. Trotzdem fand ich, dass diese lustigen Stellen dem für mich keinen Abbruch getan haben, sondern dass bestimmte Momente – ich kann Musik nicht so gut beschreiben – so melancholische Passagen, wo einfach dann doch auch ernste Gefühle von zum Beispiel einer gewissen Verlassenheit als Künstler oder als Künstlerin thematisiert wurden – das fand ich dann so berührend und ich dachte, das kann ich jetzt auch zulassen. Also ich finde das nicht nur ironisch. Sondern so in einer Art, wie man manchmal einfach bestimmte Lieder, die vielleicht ein bisschen schnulzig auch sind, sogar schön findet. Ich glaube, dass für mich auch zentral war, dass das Stück eigentlich viele verschiedene Ebenen bespielt hat. Zum Beispiel, dass nicht alles auf Gesellschaftskritik ausgerichtet war oder nicht alles auf Ironie ausgerichtet war oder auch nicht nur auf Unterhaltung ausgerichtet war. Es haben sich stattdessen all diese drei Sachen ein bisschen abgewechselt und waren alle irgendwie immer da. Dadurch ist es in bestimmte Fallen nicht getappt, finde ich. Also zum Beispiel, dass am Ende einfach so „kritische Theorie“ dahintersteht, Kritik an der kapitalistischen Lebensform, das wäre eine Falle, dass es nur das ist. Und ich finde das Stück hat mir ein Gefühl dafür gegeben, warum das vielleicht auch gar nicht geht. Dass man zum Beispiel nur ironisch ist oder nur allein Selbstausbeutung verurteilt oder nur irgendetwas macht in seinem Urteilen, weil es immer alles gleichzeitig ist. Also das ist so eine prekäre Lebensform, die aber auch etwas will, die sich ausbeutet, aber auch Träume hat. Sie ist gleichzeitig bemitleidenswert, beneidenswert, albern und schön und noch anderes wahrscheinlich.
P: Würde es dich sehr wundern, wenn andere Menschen das Stück ganz anders erleben, als du das jetzt beschrieben hast?
M: Nein. Ich könnte mir vorstellen, dass man das Stück zu stark wie so einen Gag empfinden könnte. Ich weiß nicht, ob das jemand tut, aber es würde mich nicht wundern.
P: Kannst du dir vorstellen, was an dem Stück anders sein könnte, so dass es für dich einfach nur ein Gag gewesen wäre?
M: Die Transkriptionen mit den Erfahrungen der einzelnen Künstlerinnen und Künstler, wenn die rausfallen würden, wenn es nur der Antragstext und nichts anderes wäre. Die Transkriptionen haben nochmal sowas privat-authentisches hineingebracht. Und ich kann mir vorstellen, wenn man eindeutig diesen erfolgsgewissen, großspurigen Antragsstil so durchgezogen hätte, sozusagen in vollendeter Ironie, dann wäre es eindeutig ironisch und eindeutig Unterhaltung gewesen.
P: Gab es etwas, das du vermisst hast?
M: Habe ich was vermisst? Ich finde das sehr schwer, da etwas zu finden, weil ich das immer erstmal so komplett akzeptiere, was ich so zum Beispiel im Theater sehe, und erstmal gar nicht darüber nachdenke, was man hätte anders machen können. Aber vielleicht: Es gab manchmal so ein witziges Vorsingen, das so ganz wortgetreu vielleicht auf Transkripten basiert hat. Wo sehr viel so „ähm“ vorkam, ich dachte manchmal, der Witz läuft sich so tot. Ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist, weil es vielleicht ja gar kein Witz sein soll, aber ich hatte das Gefühl, es soll ein Witz sein, und der hat sich so schnell totgelaufen und wird dann so wiederholt.
P: Kannst du beschreiben, was du erwartet hast?
M: Ich habe damit gerechnet, ein Stück zu sehen, das ich mag, das mir so Stoff zum Nachdenken bringt und einen geselligen Abend und all das habe ich bekommen.
P: Und wofür wollten die, die das gemacht haben, es dir zeigen? Was wollten die von dir?
M: Ich denke, sie wollten mir ein Stück zeigen, das aus einer Debatte, die es in den letzten Jahren gab, ein cooles Stück macht. Sie wollten diese Debatte um prekäre künstlerische Arbeit, die während der ganzen Coronazeit nochmal stärker bewusst geworden ist, auf die Bühne bringen und damit vielleicht so offensiv umgehen. Für mich haben sie was verbunden, was immer so schwer zu verbinden ist. Nämlich man hat immer das fertige Produkt, also das fertige Stück, das findet man dann schön oder gelungen oder so, und auf der anderen Seite halt die Art, wie das hergestellt wird, wie das finanziert werden muss. Das ist ganz viel debattiert worden und das muss selber zum Stück werden. Aber was wollten die, die das Stück gemacht haben, von mir? Naja, eigentlich haben sie das in dem Stück ja ein bisschen gesagt – nein, haben sie eigentlich nicht.